
Von Conakry nach Bissau – eine Grenzerfahrung
- Sandra

- 16. Aug. 2025
- 5 Min. Lesezeit
Kurz vor Boké gönnte ich mir noch einmal ein schönes Hotel. Ich konnte es kaum glauben: 24 Stunden Strom und sogar eine warme Dusche! Ein kleiner Luxus, bevor es ernst wurde. Denn diesmal war es nicht die Bürokratie am Grenzübergang, die mir Sorgen bereitete, sondern die Straße selbst.
Unzählige Male wurde ich gewarnt, diesen Übergang nach Guinea-Bissau nicht zu nehmen. Manche meinten, beide möglichen Routen seien gleich schlimm. Andere rieten mir grundsätzlich ab, in der Regenzeit nach Guinea-Bissau zu fahren. Doch ich hatte mir das Visum selbst zum Geburtstag geschenkt – und für mich gibt es schon lange keine Grenzen des Möglichen oder Unmöglichen mehr. Also: Wagen wir es!
Wie schlimm konnte es schon sein? 120 Kilometer lagen vor mir. Im schlimmsten Fall, so dachte ich, würde ich eben laufen. Meine „Weitwanderkarriere“ würde mir schon helfen – vielleicht langsam aber immer vorwärts.
Ich packte Essen für fünf Tage, falls der „worst case“ eintreten sollte, überprüfte Arby und den Anhänger und stellte sicher, dass auch ich selbst fit und gesund war. Mit einem mulmigen Gefühl bog ich auf die Straße ein.


Regenzeit und Männermeinungen
Zu meiner Überraschung war der Anfang gar nicht so schlimm: Asphalt, dann eine kurze gestampfte Piste, dann wieder Asphalt. Kurz glaubte ich, ich sei auf der falschen Strecke. Dass rund 50 Kilometer asphaltiert sind, erwähnen die ultrakrassen Radler natürlich nicht – die Männer, die diese Route in der Trockenzeit mit ultraleichten Bikes ohne Anhänger meistern und sich selbst als Abenteurer feiern.
Ich aber bin mitten in der Regenzeit unterwegs. Jeden Tag regnet es. Mein Rad ist schwer, ich ziehe einen Anhänger – und ich bin eine Frau, die das „eigentlich gar nicht kann“. Zumindest wurde mir dieses Gefühl in letzter Zeit von einigen männlichen Radreise-Kollegen gerne vermittelt.
Trotzdem kam ich gut voran. Klar, es gab Schlammfelder und Regengüsse, aber alles blieb beim Machbaren.

85 Kilometer schaffte ich bis zum Abend. Kurz vor der Flussüberquerung bat ich an einem Infanterie-Stützpunkt um Unterkunft. Ich musste die ganze Hierarchie kennenlernen, bis schließlich der „Oberste der Obersten“ zustimmte.
Hier war es tatsächlich ein Vorteil, eine Frau zu sein. Ich habe keine Ahnung von militärischen Hierarchien oder Grußregeln. Also winkte und lächelte ich einfach. Zu meiner Überraschung bekam ich ein eigenes Zimmer, in dem ich Arby aufstellen konnte. Zwar schliefen später doch Männer nebenan, aber sie ließen mich in Ruhe – und ich gönnte dem Wachmann seinen Schlaf.
Den eigentlichen „Wachposten“ übernahm ohnehin jemand anderes: „Rambo“, ein riesiger, angeketteter Pavian im Baum gegenüber. Er musterte mich erst streng, entschied sich dann aber, lieber seinen Teller Reis zu verputzen, als sich über eine verrückte Radfahrerin aufzuregen.

Auf der „wildesten Straße Afrikas“
Am nächsten Morgen wartete zuerst die Überfahrt mit einer Piroge – einem langen Einbaumboot. Der Fluss lag ruhig, die Überquerung war schnell geschafft. Auf der anderen Seite half mir ein Junge, den steilen Uferhang hochzukommen. Dann begann der Ernst: die wildeste Straße Afrikas.
Schon bald verwandelte sich der Weg in ein Meer aus Steinen, Wasserlöchern und braunen Tümpeln. Die Pfützen wirkten eher wie kleine Seen, die man nur durchwaten konnte. Immer wieder hielten Motorradfahrer an: Manche fragten besorgt, ob es mir gut ging, andere warnten vor dem, was noch kam, und einige staunten, dass ich es überhaupt so weit geschafft hatte. Zum Glück gab es auch Abschnitte, die fahrbar waren.
Schließlich erreichte ich die geografische Grenze: ein kleines Polizeihüttchen, in dem meine Daten in ein Buch eingetragen wurden. Der eigentliche Grenzposten von Guinea-Bissau lag noch drei Kilometer weiter – in Gandambel. Und diese drei Kilometer hatten es in sich.
Die Straße verschwand völlig unter einer breiten, braunen Schlammfläche. Kein Weg, kein Umweg – nur Wasser und Matsch. Ich kämpfte mich Meter für Meter voran, schob Arby und den Anhänger, immer wieder bis zu den Knien einsinkend.
Kinder tauchten auf und zogen mich wortwörtlich aus dem Dreck. Abenteuerlich – aber auch wunderschön.
Endlich erreichte ich Gandambel. Der Grenzstempel kam schnell und unkompliziert in meinen Pass. Doch für Geldwechsel und Sim-Karte musste ich ins nächste Dorf – 20 Kilometer weiter, ebenfalls über Naturstraßen.
Erste Schritte in Guinea-Bissau
Die Strecke dorthin war matschig, aber machbar. Auf den letzten fünf Kilometern wurde ich allerdings noch einmal so richtig durchnässt. Zu allem Übel erwischte mich auch noch eine Tse-Tse-Fliege – der Stich brannte wie Feuer, die Hand schwoll sofort an.

Umso stolzer war ich, als ich endlich wieder Asphalt erreichte. In einem kleinen Restaurant bekam ich eine heiße Suppe, die mich fast zu Tränen rührte. Nebenan bot mir der Besitzer spontan eine Unterkunft an und half sogar, Arby zu waschen. Wenig später war Rad und Anhänger vom Schlamm befreit.
Die Nacht allerdings war alles andere als erholsam. Kein Strom, kein Ventilator – die Luft war stickig und heiß. Schließlich zog ich nach draußen auf die Terrasse. Am frühen Morgen weckte mich starker Wind, gefolgt von Regen. Die Hand von dem Tse-Tse-Stich pochte schmerzhaft.
Unerwartete Glücksfunde
In Quebo, nur acht Kilometer weiter, fand ich einen Mechaniker – und konnte mein Glück kaum fassen: Er verkaufte tatsächlich originale Shimano-Teile! Die Reifen meines Anhängers waren schon wieder heruntergefahren, nach nur 1300 Kilometern. Nun konnte ich sie ersetzen. Mal sehen, wie lange diese halten.
Eigentlich wollte ich auf der Nationalstraße in die Hauptstadt fahren, entschied mich dann aber für den direkteren, ungeteerten Weg. Der Anfang war zwar asphaltiert, aber voller Schlaglöcher. Trotzdem: Die Fahrt nach Bula war wunderschön und einsam.
Am nächsten Tag folgte einer der schönsten Abschnitte meiner Reise. Eine gut gestampfte Naturstraße, gesäumt von Palmen und dichtem Dschungel. Und das Beste: Es blieb fast den ganzen Tag trocken. 75 Kilometer bis Enxunde.

Fischer, Netze und ein Rochen
Die Fähre nach Bissau fuhr erst am nächsten Tag. Die lokalen Fischer nahmen mich sofort freundlich auf und boten mir einen Schlafplatz am Hafen an. Mit geübten Händen flickten sie ihre riesigen Netze, während Tee auf kleinen Kohleöfen dampfte.
Am Ufer lag ein Rochen – frisch gefangen. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich so ein großes Tier außerhalb des Meeres.
Die Nacht verbrachte ich in einer Wellblechhütte direkt am Hafen, gemeinsam mit unzähligen anderen Menschen. Wie viele Menschen tatsächlich in diesem Raum schliefen, weiß ich bis heute nicht. Es war ein klassischer afrikanischer Abend: eine billige Telenovela auf dem kleinsten Handy der Welt, laute Handymusik, ein Streit im Nachbarhaus, Schnarchen – und am Morgen der Rauch der Feuerstellen in meiner Nase.
Chaos auf der Fähre – und Ankunft in Bissau
Am Morgen musste ich mich irgendwann aus meinem Zelt schälen. Mein Moskitonetz bot ohnehin keine Privatsphäre, aber es fühlte sich doch wie ein kleiner Rückzugsort an. Ich war noch nie ein Morgenmensch – und je älter ich werde, desto länger brauche ich, bis ich bereit bin, Menschen zu ertragen.
Natürlich hatte die Fähre mehrere Stunden Verspätung. Als das Horn schließlich ertönte, brach das typische Chaos los: Menschen drängten, Arbeiter schleppten schwere Cashew-Säcke, ich mitten drin mit Arby. Zum Glück half mir ein junger Mann, das Rad auf das Deck zu tragen.
Die Überfahrt dauerte eine Stunde. Kurz vor Bissau tauchten wir in eine dunkle Regenwand ein. Strömender Regen, genau in dem Moment, als ich im Hafen ankam. Durchnässt und müde erreichte ich das nächste Hotel – und war sofort begeistert von der Altstadt: farbenfrohe Kolonialhäuser, freundliche Menschen, eine lebendige Stimmung.
Hier werde ich bleiben, ein paar Tage Pause einlegen – und Bissau genießen.













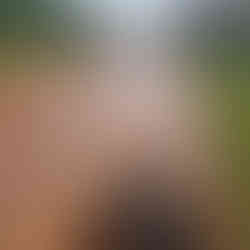




















































































Kommentare